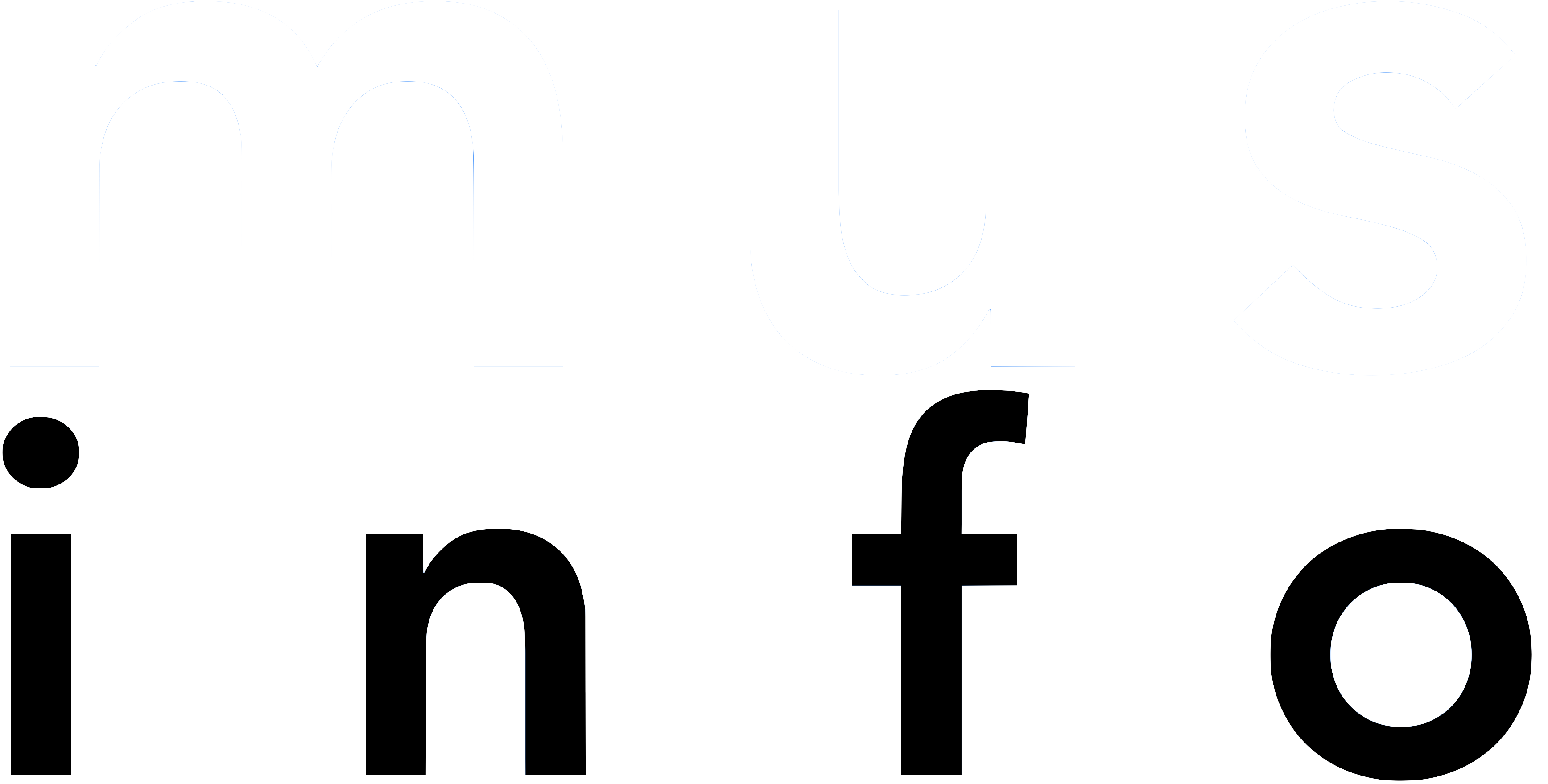Musik und Vanitas
Das Musikensemble als Symbol der Institution
Musik ist der Inbegriff des Vergänglichen: Vanitas. Kaum ist der Ton hervorgebracht, ist er schon verklungen. Alles Festhalten ist vergeblich. Das Verklingen zeigt beständig, dass der Geltungsdrang der Musiker, die sich da produzieren wollen, nur von kurzer Dauer ist: Er ist «eitel» in der ursprünglichen Bedeutung des Worts. Die Überwindung der Eitelkeit und die Einigung auf ein Gemeinsames im Bewusstsein der Vergänglichkeit sind daher zu einem Programm der Neuzeit geworden.
Die Vorstellung, dass man mit Noten (und später mit Tonaufzeichnungen) etwas Wesentliches festhalten könne, ist etwas Modernes. So wie Echo oder Schatten sind sie ursprünglich bloss der Abglanz einer lebendigen Äusserung. Das Echo als täuschender Schein ist ein häufiges Thema in der Musik von Renaissance und Barock. Wenn eine lustige Musik im 16. Jahrhundert den Tod symbolisiert, ist das kein Widerspruch, weil den damaligen Hörern klar war, dass dieses Lustige nur Schein und Schatten ist, also eine Art Totentanz.
Der Wandel in der Folgezeit ist markant: Dass Instrumente und Musiknoten jederzeit wieder gespielt werden könnten – oder dass aufgezeichnete Musik auch ohne Musiker noch Musik bleibt –, ist eine moderne Auffassung, die behaupten will, dass der Ersatz doch kein Ersatz sei. Negativ gesagt, setzt sie voraus, dass man den Respekt vor der konkreten Situation, für die diese Musik bestimmt war, und vor dem individuellen Musiker, der sie einst gespielt hat, verloren hat. Beide hält man für ersetzbar. Wenn eine Musik ausschliesslich für eine Fürstenhochzeit bestimmt war und die Violinstimme ausschliesslich für einen bestimmten Violinisten, dann zeigen diese Noten heute lediglich, dass das Fest vorbei und der Musiker gestorben ist. Sie sind ein trauriges Relikt, ein Mahnmal der Vergänglichkeit, kein faszinierendes Modell, das zur immer neuen Interpretation oder erneuten Wiedergabe einlädt, um das Vergangene ein weiteres Mal verfügbar zu machen, wie man es seit dem 19. Jahrhundert zunehmend versteht.
Das Musikinstrument ist bis zum 18. Jahrhundert nur eine Stütze oder ein notdürftiger Ersatz für die Menschenstimme. Sein Ton zeigt das Fehlen des wirklichen Gesangs. Und ohne Musiker ist es bloss eine leblose Prothese. Die stummen Musikinstrumente auf den Stillleben des 17. Jahrhunderts zeigen ebenso wie stumme Musiknoten auf vergilbten Notenblättern lediglich das Fehlen des Menschen an. Sie können kein Ersatz für Menschen sein, so wie ein Gemälde kein Ersatz für Menschen ist, die es abbildet: Portraits blicken blind und ungerührt auf ihre Betrachter, so «lebendig» diese Personen auch dargestellt sein mögen.
Der Ersatz wird nach und nach zum Eigentlichen umgewertet: Die unbeholfene Nachahmung des menschlichen Gesangs durch Musikinstrumente wird schon seit dem 17. Jahrhundert umgekehrt zum Vorbild der Gesangsstimme gemacht, die dann zum Beispiel instrumentale Verzierungen auszuführen hat. Gewissermassen als Höhepunkt dieser Entwicklung darf die besungene tote Eurydike in Christoph Willibald Glucks Oper Orfeo ed Euridice (1762) erstmals lebendig dem Hades entsteigen – nicht mehr als blosse Einbildung, weil der Mensch nicht die Fähigkeit besitze, etwas wirklich zu beleben. Die Frau als Werk war geboren, die Statue des Bildhauers Pygmalion begann zu leben wie Aphrodite einst dem Schaum des Meers entstieg, aber nicht mehr auf göttlichen, sondern auf menschlichen (beziehungsweise männlichen) Befehl. Die musikalische «Klassik» hat begonnen.
In der westlichen Musikgeschichte wird die flüchtige Musik zunehmend zum Bleibenden stilisiert. Mit Hilfe der Notenschrift entsteht seit dem 18. Jahrhundert ein Repertoire, das bis heute erweitert wird, so dass wir fast die gesamte schriftlich festgehaltene musikalische Vergangenheit als klingende Gegenwart erleben können. Zur selben Zeit entsteht auch etwa die Archäologie, die antike Ruinen nicht mehr als mahnende Zeichen des untergegangenen Heidentums, sondern als ewige Gegenwart eines Klassischen deutet.
[...]
Lesen Sie den vollständigen Artikel in DISSONANCE 113 (März 2011).